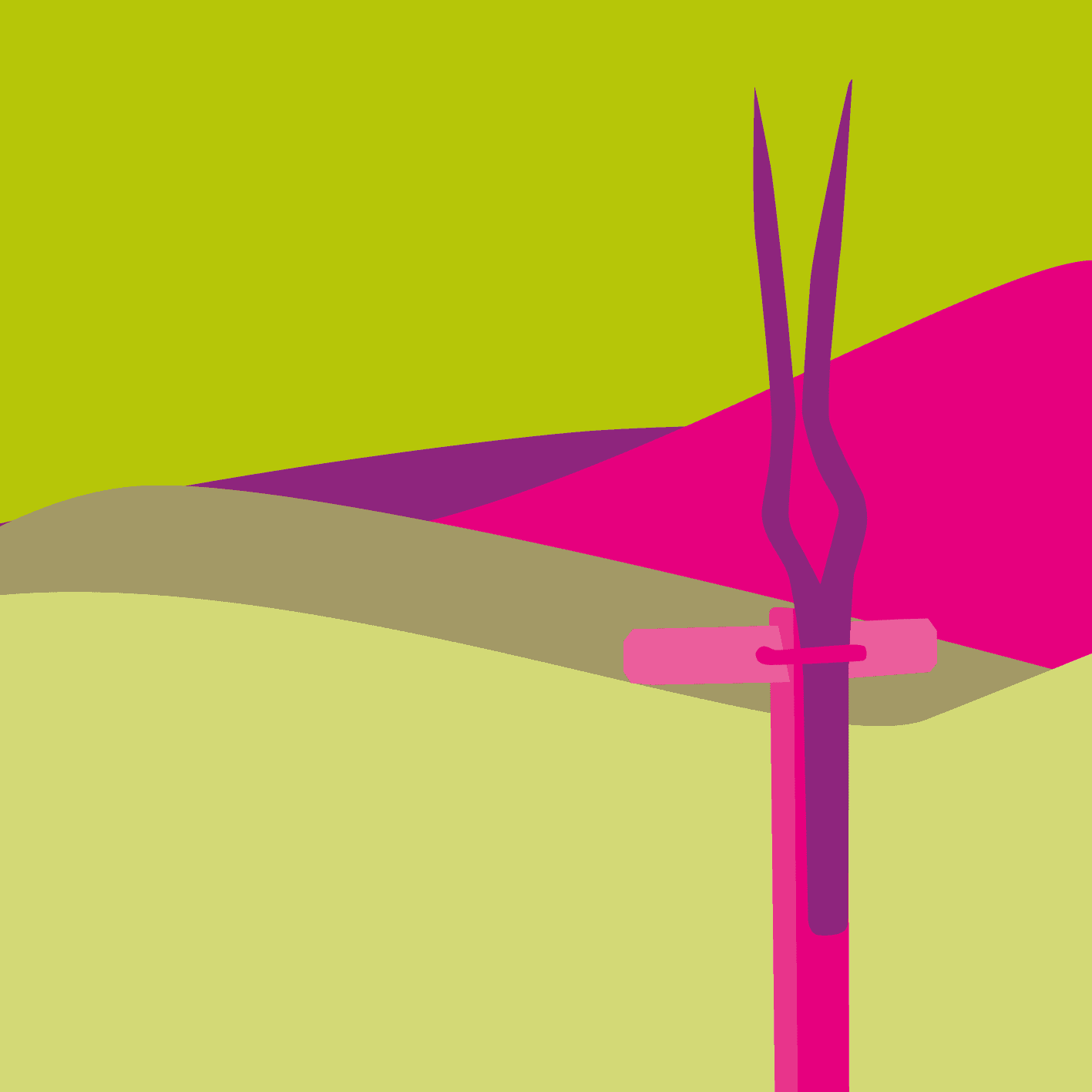Hier teilen wir den Introtext zur Veranstaltung Landwirtschaft ist Care-Arbeit, ist Kulturarbeit und mit uns allen verknüpft!, die am 12. Juni 2025 stattfand:
Im POT Netzwerk- und rampe5-Team ist es uns seit langem ein Anliegen eine queerfeministische Auseinandersetzung mit der Landwirtschaft öffentlich zu führen. Denn die klassischen Vorstellungen von produktiver und reproduktiver Arbeit sind in der Landwirtschaft nochmals in besonderem Masse miteinander verwoben.
Einerseits weil alles auf engem Raum passiert: Der Haushalt, der Wohnraum und die klassisch «reproduktive» Care-Arbeit sowie der «produktive» Lohn-Arbeitsplatz befinden sich am gleichen Ort.
Andererseits ist die landwirtschaftliche Arbeit konstant und gleichzeitig produktive und reproduktive Arbeit. Damit meine ich: während wir beispielsweise Kohl anbauen, pflanzen wir Blumen dazwischen, um den Nützlingen Nahrung zu schenken, wir bauen – im besten Falle – den Boden auf und nähren ihn, während wir auch unsere Nahrung anbauen. Das zeigt sich auch bei der Arbeit mit Tieren: wir pflegen sie, nähren sie, helfen bei ihren Geburten, um sie schliesslich zu Melken, um ihre Milch für uns zu nehmen oder schlachten sie, um uns ihr Fleisch verfügbar zu machen.
Im Titel der Veranstaltung steht darum auch programmatisch die Behauptung: Landwirtschaft ist Care-Arbeit. Weil uns wichtig ist, dieses Arbeitsfeld in diesen Diskurs einzubinden.
Denn auch hier in der Landwirtschaft sind wir in ständiger Beziehungsarbeit – mit Menschen, Tieren, Kleinstlebewesen und Pflanzen. Es ist eine Subjekt-Subjekt-Beziehungsarbeit und auch diese Arbeit kann nicht unendlich effizienter und günstiger werden.
Und wie in allen anderen Care-Berufen, sind auch die Löhne in diesem Sektor katastrophal. Die Landwirtschaft ist – wie auch die Sexarbeit – nicht durch das Arbeitsgesetz geregelt. Die Kantone schlagen Normalarbeitsverträge vor, welche die Bestimmungen im OR ergänzen. Im Kanton Zürich wird die maximale Arbeitszeit von 55 Wochenarbeitsstunden empfohlen. Wie die Studie des Bundesrates von vergangenem Jahr zeigte, liegt der schweizweite Durchschnittslohn bei Fr. 17.– auf die Stunde.
Wobei 70 % der Bäuer:innen nicht einmal offiziell angestellt sind und demzufolge keine Sozialversicherung erhalten. Es ist auch legal, saisonal arbeitende Menschen aus dem Ausland mit 13.60 pro Stunde zu bezahlen. Mit allen Abzügen für Kost und Logis beläuft sich der Lohn auf 11.– / Stunde.
Die schlechtbezahltesten Bereiche in der Landwirtschaft sind mit der Handarbeit verbunden und wie in den klassischen Care-Berufen ebenfalls stark feminisiert und auch rassifiziert.
Und zur Klärung der verschiedenen Berufsbezeichnungen in der Landwirtschaft möchte ich vorgängig noch kurz was dazu sagen: Um Land in der Schweiz kaufen und es bewirtschaften zu dürfen, muss Mensch eine Direktzahlungsberechtigung haben. Diese kann durch einen Studienabschluss in Agrarwissenschaften u.ä., dem Nebenerwerbskurs oder einer der folgenden Berufsabschlüsse erwerben:
Landwirt:in, Gemüsegärtner:in oder Bäuer:in. Der Beruf der Landwirt:in in der Schweiz fokussiert die klassischen landwirtschaftlichen Themen: Nutztiere (Milch- und Fleischproduktion), Futterbau (für die Tiere), Ackerbau (Getreide, Kartoffeln, Karotten). Bereiche, die unterdessen alle mit grossen Maschinen und stark industrialisiert funktionieren können. Die Gemüsegärtner:innen kümmern sich um den Gemüseanbau. Das sind Lehren mit einem EFZ-Abschluss. Die Bäuerin hingegen, absolviert die Bäuerinnenschule in einem Jahr und erhält einen Fachausweis. Die Ausbildung fokussiert u.a. die Haushaltsführung, die Direktvermarktung, die Buchhaltung, den Selbstversorgungsgarten, die Lebensmittel-Verarbeitung.
Wir werden im Gespräch nochmals genauer darauf eingehen, inwiefern diese Berufskategorien vergeschlechtlicht sind und wie sie mit Anerkennung und Lohn ausgestattet sind. Und vor allem auch welche Menschen ohne diese Qualifikationen unter welchen Arbeitsbedingungen systemrelevante Arbeit leisten.
Wir schauen uns in einem ersten Teil mit Annalena diese traditionellen Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft an, wie sie sich historisch herausgebildet haben, wie das bäuerliche Bodenrecht diese Verhältnisse stärkt. Wir besprechen welche Veränderungen anstehen und welche Forderungen wir hier sehen.
In einem zweiten Teil möchten wir «Landwirtschaft» mit einem queerfeministischen Blick lesen. Einerseits Dualismen wie Natur-Kultur, Mann-Frau, Landwirtschaft-Gemüsegarten in Frage stellen, sowie den favorisierten Kleinfamilien-Zugang-zu-Land kritisch beleuchten. Wir hören von solis Erfahrung als queere Person in diesen Zusammenhängen und von Initiativen, die neue Wege gehen.
In einem dritten Teil möchten wir mit Annika den Blick auf die Rassifizierung entlang der landwirtschaftlichen Tätigkeiten legen. Wie werden unsere Felder bestellt? Wieviel Swissness steckt in den «schweizer Lebensmitteln»? Und vor allem, wie geht es Menschen, die saisonal hier arbeiten und welche Initiativen zur Verbesserung der Situation gibt’s oder braucht es?
Rückblick
Wir haben uns über das grosse Interesse an dieser Thematik unheimlich gefreut und an diesem Abend ein engagiertes Gespräch mit 25 Menschen geführt.
Weiterführende Links zu den Themen
FiBL Focus Podcast: Queer, sichtbar und zukunftsweisend
FiBL Focus Podcast: Frauen in der Landwirtschaft – ein Rollenbild in Bewegung
Echo der Zeit: Schweiz weiss kaum etwas über saisonale Arbeitskräfte
FiBL Focus Podcast: Feldarbeit ohne Grenzen – Arbeitsmigration in der Landwirtschaft
Artikel Neue Wege: Was hat Landwirtschaft mit Care-Arbeit zu tun? Von Bettina Dyttrich